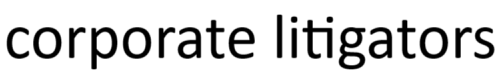Die Reichweite des Weisungsrechts gegenüber dem GmbH-Geschäftsführer
Das Verhältnis zwischen den Gesellschaftern einer GmbH und ihrem Geschäftsführer ist von einem Spannungsfeld geprägt: Einerseits soll der Geschäftsführer das operative Geschäft eigenständig führen, andererseits behalten die Gesellschafter über ihr Weisungsrecht die letzte Kontrolle. Doch wie weit reicht dieses Weisungsrecht tatsächlich – und wo liegen seine Grenzen?
1. Gesetzliche Grundlage
Das Weisungsrecht der Gesellschafter gegenüber dem Geschäftsführer ergibt sich aus § 37 Abs. 1 GmbHG:
§ 37 Beschränkungen der Vertretungsbefugnis
(1) Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche für den Umfang ihrer Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, durch den Gesellschaftsvertrag oder, soweit dieser nicht ein anderes bestimmt, durch die Beschlüsse der Gesellschafter festgesetzt sind.
(2) Gegen dritte Personen hat eine Beschränkung der Befugnis der Geschäftsführer, die Gesellschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Dies gilt insbesondere für den Fall, daß die Vertretung sich nur auf gewisse Geschäfte oder Arten von Geschäften erstrecken oder nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten stattfinden soll, oder daß die Zustimmung der Gesellschafter oder eines Organs der Gesellschaft für einzelne Geschäfte erfordert ist.
Damit schreibt das Gesetz vor, dass der Geschäftsführer an die Vorgaben des Gesellschaftsvertrags und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung gebunden ist. Praktisch bedeutet das:
- Die Gesellschafterversammlung kann konkrete Anordnungen zum Handeln oder Unterlassen erteilen.
- Der Geschäftsführer ist verpflichtet, diesen nachzukommen.
Hält der Geschäftsführer eine Weisung für unzweckmäßig oder wirtschaftlich nachteilig, muss er die Gesellschafter hierauf hinweisen. Bestehen diese dennoch auf der Umsetzung, hat der Geschäftsführer den Beschluss weisungsgemäß auszuführen – auch wenn er ihn für unvernünftig hält.
2. Typische Weisungsinhalte
Das Weisungsrecht umfasst sowohl allgemeine strategische Vorgaben als auch konkrete Einzelweisungen. Beispiele:
- Vorgabe, neue Geschäftsfelder zu erschließen oder bestimmte Investitionen zu unterlassen.
- Anweisung, Rechtsstreitigkeiten zu führen oder beizulegen.
- Festlegung von Finanzierungsstrategien.
Mit dem Weisungsrecht haben die Gesellschafter ein mächtiges Instrument, um das Unternehmen in ihrem Sinne zu steuern. Bei hoher Weisungsdichte können die Gesellschafter die Geschäftsführung beinahe auf reines Ausführungsorgan reduzieren.
3. Grenzen des Weisungsrechts
So umfassend das Weisungsrecht ist – es gilt nicht grenzenlos. Einige Bereiche fallen nicht in den Anwendungsbereich des Weisungsrechts und können daher auch nicht durch Gesellschafterbeschlüsse gesteuert werden. Hier ist der Geschäftsführer allein den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet. Dies betrifft etwa
- die Insolvenzantragspflicht nach § 15a Abs. 1 InsO. Ist die Gesellschaft insolvenzreif, ist der Geschäftsführer verpflichtet, unverzüglich einen Insolvenzantrag zu stellen. Gegenteilige Bitten oder Weisungen der Gesellschafter sind unbeachtlich.
- Dem Weisungsrecht entzogen sind die Pflicht zur Abführung der Steuern und Sozialversicherungsabgaben (vgl. § 34 Abs. 1 AO) sowie zur Erfüllung sonstiger öffentlich-rechtlicher und handelsrechtlicher Anmeldepflichten.
- Nicht statthaft sind darüber hinaus Weisungen im Zusammenhang mit den Pflichten zur Sicherung des Stammkapitals (§§ 30 ff GmbHG). So wäre beispielsweise die Weisung der Auszahlung des zur Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen Vermögens an die Gesellschafter unzulässig.
- Gleiches gilt für Weisungen hinsichtlich der Verpflichtung zur ordnungsmäßige Buchführung (§ 41 GmbHG) und den Publizitätspflichten (§§ 325 ff. HGB).
Der Geschäftsführer ist mithin nicht bloßer Befehlsempfänger. Es verbleibt selbst bei hoher Weisungsdichte ein weisungsfreier Kernbereich an Pflichtaufgaben, deren Missachtung zu Haftungsrisiken führt.
4. Zuständigkeit
Weisungen können nur von der Gesellschafterversammlung durch entsprechenden Beschluss erteilt werden. Eine Weisung einzelner Gesellschafter – selbst des Mehrheitsgesellschafters – genügt nicht. Die Gesellschafterversammlung kann, sofern gewünscht, ihre Befugnis jedoch auf einen Aufsichtsrat oder Beirat übertragen.
5. Fehlerhafte Weisungsbeschlüsse
Im Einzelfall können die durch die Gesellschaftsversammlung gefassten Weisungsbeschlüsse fehlerhaft, d.h. nichtig oder anfechtbar sein.
Nichtige Weisungsbeschlüsse entfalten gegenüber dem Geschäftsführer keinerlei Wirkung – unabhängig davon, ob die Nichtigkeit aus formellen oder materiellen Gründen resultiert. Beruht die Nichtigkeit des Beschlusses auf materiellen Gründen (z.B., weil er gegen die guten Sitten oder gegen zwingendes Recht verstößt) handelt der Geschäftsführer sogar pflichtwidrig, wenn er der Weisung Folge leistet. Ist der Beschluss aus formellen Gründen nichtig (z.B. wegen eines Ladungsmangels), kann der Geschäftsführer im Einzelfall gehalten sein, auf eine wirksame Beschlussfassung hinzuwirken.
Bei anfechtbaren Weisungsbeschlüsse ist zu differenzieren, ob ein Gesellschafter innerhalb der Anfechtungsfrist Anfechtungsklage erhoben hat oder nicht. Hat kein Gesellschafter den Weisungsbeschluss innerhalb der Anfechtungsfrist mit der Anfechtungsklage angegriffen, so hat der Geschäftsführer den nunmehr unanfechtbaren Weisungsbeschluss auszuführen. Läuft die Anfechtungsfrist hingegen noch oder wurde fristgemäß Anfechtungsklage erhoben, besteht für den Geschäftsführer Unklarheit über die Wirksamkeit des Weisungsbeschlusses. Für diesen für den Geschäftsführer unangenehmen Schwebezustands gibt es keine klaren Vorgaben, vielmehr muss der Geschäftsführer die Erfolgswahrscheinlichkeit der Anfechtungsklage prüfen bzw. sachkundig prüfen lassen und nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, wie er weiter verfährt.
6. Fazit
Das Weisungsrecht ist ein zentrales Steuerungsinstrument der Gesellschafter und Ausdruck ihres Eigentümerwillens. Gleichwohl findet es klare Grenzen dort, wo Gesetze verletzt würden oder die persönliche Verantwortung des Geschäftsführers unzulässig beschnitten wird. Für Geschäftsführer gilt daher: Weisungen genau prüfen, dokumentieren und bei Zweifeln fachkundigen Rat einholen.
Sie haben Fragen zum Weisungsrecht ?
FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Weisungsrecht
Können die Gesellschafter selbst tätig werden, wenn der Geschäftsführer die Umsetzung einer Weisung verweigert?
Nein. Gesellschafter können nicht an Stelle des Geschäftsführers handeln. Sie können ihn nur abberufen, auf Erfüllung verklagen oder bei Pflichtverstößen in Haftung nehmen (§ 43 GmbHG).
Benötigt eine Ein-Personen-Gesellschaft auch einen formellen Weisungsbeschluss?
Nein. Der Wille des Alleingesellschafters entspricht dem Willen der Gesellschaft, so dass ein Beschluss entbehrlich ist.